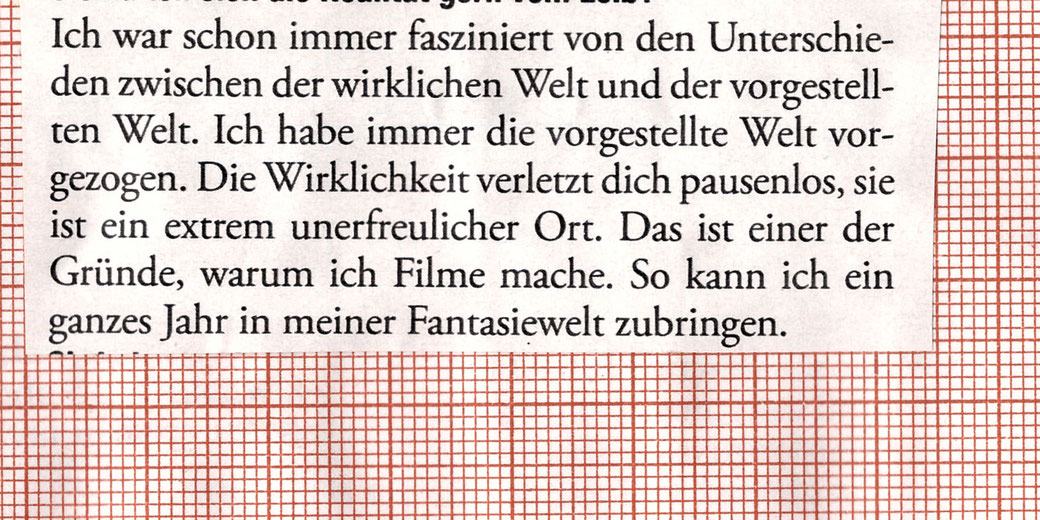
Texte ::: zum Werk von Bernd Hennig
Dr. Susanne Ramm-Weber, Kunstwissenschaftlerin | Künstlerkreis Offenburg, Galerie im Artforum, 2017
Der König der Welt betrachtet ein schwarzes Loch
Die Arbeiten von Bernd Hennig geben Anlass, um sich über drei wesentliche Themen Gedanken zu machen: Größenverhältnisse, zwischenmenschliche Beziehungen und
die Wahrnehmung.
»Der König der Welt betrachtet ein schwarzes Loch« … Der Titel der Ausstellung, der einer einzelnen Arbeit entnommen ist, gibt viel vor. Nicht irgendein König,
sondern der König der Welt. Wer ist dieser König? Die Einladungskarte zur Ausstellung im Artforum im November 2017 suggeriert eine majestätische Figur. Umso größer ist die Überraschung in der
Originalansicht. Eine kleine bemalte und als Gipsabguss modellierte Figur, barfuss, bekleidet mit einer schlabberigen Hose, der Oberkörper entblößt, eine mächtige weiße Krone von schlichter Form
auf dem Kopf, von nicht gerade majestätischer Statur, die Schultern hängend, nach vorne gebeugt mit rundem Rücken, den Kopf leicht geneigt. So steht er vor einer Wand, die nichts anderes enthält
als ein schwarzes Loch. Der Blick ins Nichts, oder ist ein schwarzes Loch nicht NICHTS, sondern eben ETWAS? In der physikalischen Farblehre ist Schwarz die Abwesenheit von Licht, die Summe aller
Farben. Das »Schwarze Loch« kennt man als Begriff aus der Astrophysik, der Wissenschaftler Stephen Hawking hat darüber geforscht: Das »Schwarze Loch« ist definiert als »ein Objekt, das in seiner
unmittelbaren Umgebung eine so starke Gravitation erzeugt, dass weder Materie noch Information diese Umgebung verlassen kann.« (Wikipedia, 06.11.2017) Es zieht also ALLES an sich. ALLES. Der
König setzt sich der Gefahr aus, er könnte vom »Schwarzen Loch« verschlungen werden, die Umgebung nicht mehr verlassen. Vielleicht interessiert er sich nur, vielleicht ist er ein Betrachter, so
wie wir jedes Kunstwerk betrachten. Mit welchem Abstand betrachtet der König der Welt das »Schwarze Loch«? Der Kosmos, symbolisiert im »Schwarzen Loch«, und die Welt, der König als ihr Vertreter,
werden hier in einen Zusammenhang gebracht, nicht mehr und nicht weniger. Reduktion auf Wesentliches ist ein Markenzeichen der Kunst von Bernd Hennig, die mit wenig und Vielsagendem zugleich
auskommt, gezielt, pointiert gesetzt. Dieser Eindruck des Symbolhaften entsteht sofort aufgrund der klaren Formensprache. Das provoziert eine Interpretation, es ist ETWAS gesagt, längst nicht
ALLES. Ist dieser König überhaupt ein Weltenherrscher? Die majestätische Krone und die Gestalt, bilden sie nicht einen Widerspruch?
Nun ist der titelgebende König eine kleine Figur. Anders sieht es aus, wenn man sich die nach einem lebenden Modell gearbeitete Figur von Menschengröße anschaut, der König für sich steht. Die Größenverhältnisse sind interessant im Hinblick auf die Aussagen. Die ganze Welt und der Kosmos – das ist ein Riesenthema, und im Gegensatz dazu ist die Arbeit ganz klein von Gestalt. Etwas Kleines kann also sehr groß sein. In der Ganzkörperfigur kommt hingegen eine bestimmte Haltung stärker zum Ausdruck, die wir mit einer Rolle, einer Aussage, einer Geste in Verbindung bringen können, ein reuiger Sünder vielleicht, oder jemand, der um Vergebung bittet. In der Ausstellung ist der große König aufgestellt, als betrachte er den kleinen König und seine Szene, vielleicht mit Wohlwollen. Jedem Betrachter mag weiteres oder anderes einfallen.
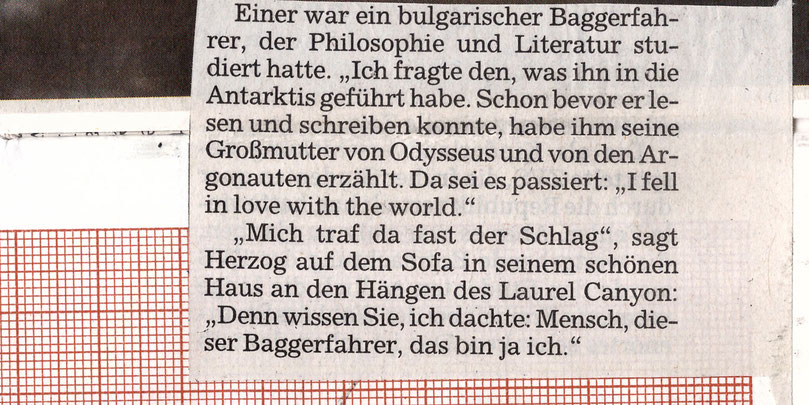
Das Thema Beziehung wird in den Arbeiten »Königstische« behandelt. Das Verhältnis zwischen den auf einem Tisch (Epoxidharz) arrangierten Halbporträts eines Königs
und einer Zitrone spricht für sich, Zuwendung und Abwendung, Nähe und Distanz, was in einer Beziehung eben vorkommen kann, serviert und angerichtet. Auch hier dominieren spannungsreiche
Größenverhältnisse die Gestaltung, dünne lange Beine und hoch darauf eine dünne Platte, oder der König zwischen zwei hart gekochten Eiern, der König ganz er selbst. Warum es keine Himbeere gebe,
sondern nur Zitronen, will ich während des Atelierbesuchs wissen. Das Loch in der Platte sei zu groß, sie würde hindurch fallen, lautet die Antwort des Künstlers ganz pragmatisch.
Die spannungsreiche Gestaltung der Arbeiten bewirkt eine Lebendigkeit. Man schaut gerne hin. Schließlich ist die phantastische Arbeit, »13 Könige warten auf
Renate«, entstanden, die Blickbeziehungen thematisiert. Die Arbeit erweckt den Anschein, als ragen dreizehn Könige mit Brust und Kopf stehend aus dem Wasser, während eine Frauenfigur, kenntlich
an Kopf, Brust, Körper und Oberschenkeln zu schwimmen scheint. Die halb obenauf schwimmende »Renate« wird so zum Objekt der Begierde, mindestens der Betrachtung der dreizehn im Kreis um sie
versammelten Könige. Die Arbeit reizt aus, was sichtbar ist und was scheinbar unter der Wasseroberfläche verborgen bleibt, sie regt die Phantasie im Betrachter an.
Das konzeptuelle Vorgehen des Künstlers ist auch an den Zeichnungen ersichtlich, beispielsweise an der Raumzeichnung des »König der Tiere, der das Ende des Hasen
betrachtet«. Erst mit genügend Distanz wird die Umrisszeichnung des Hasen ersichtlich, in welche der König hineinragt, Teil von ihr wird, den Blick von innen her auf das Hinterteil des Hasen
gerichtet, dem Blick des Hasen entgegen gesetzt. Auch hier entsteht eine Beziehung, die Figur und die gezeichnete Linie sind in ein Verhältnis gesetzt. Der Hase, -oder ist es eine Häsin?- ist
natürlich prominent besetzt, nicht nur als Fruchtbarkeitssymbol, sondern vor allem durch das Hasenbildnis von Albrecht Dürer, das im Original in Wien in der Albertina hängt, und durch frühe
Reproduktionen eine Verbreitung gefunden hat, wie kaum ein anderes Werk. Insofern erhält die Arbeit einen gedachten kunsthistorischen Bezug. Nur: Wer den Dürer-Hasen nicht kennt, dem ist dieser
Gedanke fern. Die verschiedenen Augen, mit denen jeder Betrachter sieht, fallen auf die Objekte.
Die Zeichnungen thematisieren außerdem die Sichtbarmachung von Wahrnehmung, der Titel dieser Arbeiten schlicht »Ich seh dich I und
II«. Die dreiteilige Arbeit »Ich seh dich I« zeigt einen Kopf von vorn und einen von hinten, sehen und gesehen werden, farbige Punkte beleben das Arrangement. Die dreiteilige Arbeit »Ich seh dich
II« zeigt zwei Köpfe, aus deren Augen sich vom Punkt aus Strahlen wie zur Markierung eines Sehfeldes öffnen, im Gegenzug die auf den Kopf gestellte Abbildung, wie das Abbild auf der Netzhaut. Die
Strahlen überschneiden einander, die Blicke begegnen sich, in der Mitte entsteht ein Spielfeld. Eine eigene unregelmäßige Charakteristik entwickelt die aus Draht zwischen zwei Lagen von
Seidenpapier gewobene Linie, die nicht durchgängig gleich, sondern unregelmäßig ist. Aus ihr sind Köpfe und Strahlen geformt. Die Unregelmäßigkeit durch das Material steht im Gegensatz zur klar
und einfach gedachten Linie, die in der Zeit veränderlich ist, Rost setzt an. Mit den Farbfeldern, kleinen Punkten oder größeren Flächen erhalten die Arbeiten eine weitere Dimension, spielerisch
und anregend. In einer dritten Arbeit ist das Thema noch einmal modifiziert. Bernd Hennig, der Mitglied im Deutschen Künstlerbund ist und von 1994 bis April 2017 eine Professur für Design an der
Hochschule Dessau innehatte, gelingt es, die Erkenntnisse aus dem Design, die klare, einfach gehaltene bildliche und formal starke Sprache für eine eigene künstlerische Aussage zu nutzen.
Mitunter reicht die Andeutung, etwa wenn der König nur als Brustfigur zu sehen ist, als schwimme er im Wasser. Die Anregungen können auch aus Kinderspielen kommen. »Ich sehe was, was du nicht
siehst« ist der Titel einer Arbeit, in der eine Frauenfigur durch die Änderung ihrer Position von Bild zu Bild ihr Blickfeld ändert, und so zugleich die Dreidimensionalität auf der
zweidimensionalen Fläche thematisiert, ein Anliegen der Malerei seit der Erfindung der Zentralperspektive in der Renaissance. Wenn, wie in den Arbeiten von Bernd Hennig, Form und Inhalt eine
Einheit eingehen, entfaltet die Kunst ihre größte Wirkung.
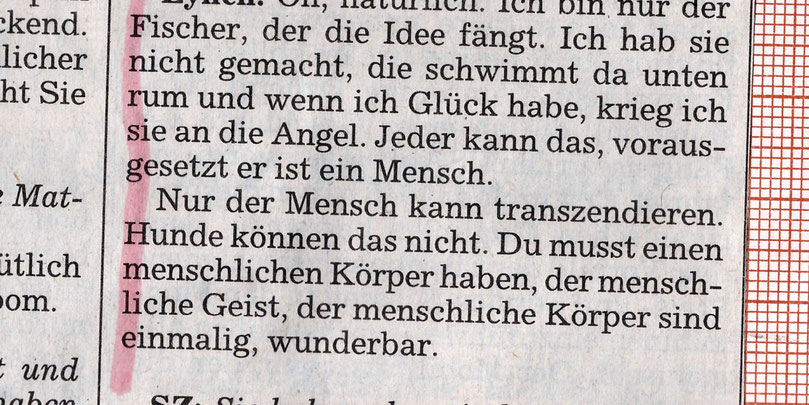
Dorothée Bauerle-Willert | Anhaltischer Kunstverein, Dessau, 2016
Im Glashaus
Mit Musil zeigt sich alle Wirklichkeit in unseren Erlebnissen und Forschungen nie anders wie durch ein Glas, das teils den Blick durchläßt, teils den
Hineinblickenden widerspiegelt.
Die Ausstellung Im Glashaus nimmt mit diesem Titel einmal die lange Fensterfront des aktuellen Raums im Anhaltischen Kunstvereins Dessau auf: Schaufenster und die
Ausstellungsarchitektur verwandeln Glas in ein bedeutungstragendes Medium. Das Glas der Fenster, der Vitrinen ist ein Instrument der Fokalisierung, setzt ein emotionales Verhältnis zwischen
Betrachter und dem isolierten Objekt der Betrachtung in Gang. Es rahmt Personen und Gegenstände ein, lenkt den Blick und bestimmt die Art, wie sich das Sichtbare dem Flaneur darbietet. Zugleich
aber eröffnen die dort gezeigten Arbeiten der Professoren der Hochschule Anhalt Dessau eine Untersuchung über Sehen und Sichtbarkeit. Das Wahrgenommene bildet immer auch eine Projektionsfläche
des Wahrnehmenden.
Nicht nur in Museen und Schaufenstern sehen wir Bilder und Dinge hinter Glas, Reflektion, Projektion, das Eigene und das Andere sind im Wahrnehmen verwoben, so wie
der Traum von Transparenz und das Trauma der Splitterung, das unsere Weltsicht prägt, im Assoziationsraum Glashaus sich berühren.
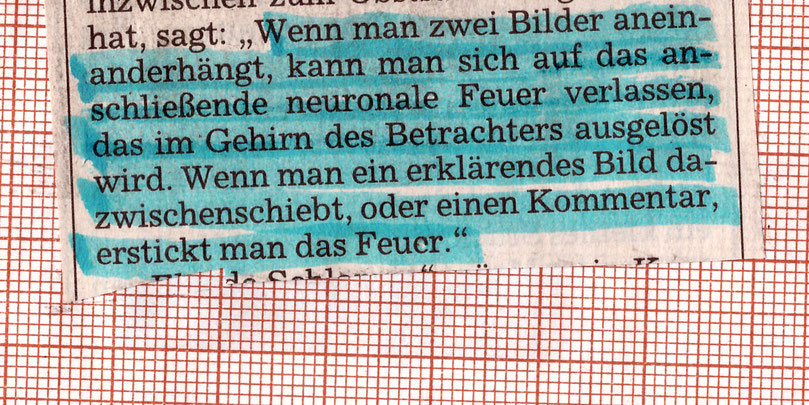
Das Sehen des Sehens ist auch Thema der Zeichnungen Bernd Hennigs, die im Triptychon auf und aus Seidenpapier Sichtbarkeit und Sichtbarwerdung, Ansicht und
Rücksicht, Perspektive und ihre Verkehrung umkreisen. Die (mit Draht gestickte) Linie, Farbe, die transluzente Struktur des Papiers inszenieren in aller Offenheit Figurationen des Schauens. Was
wir sehen, blickt uns an. Es stiftet eine taktile Beziehung. Distanz und Nähe, der vorübereilende Moment und das Ergreifende sind im Blick, im Bild untrennbar miteinander verwoben. In Hennigs
skulpturalen Anordnungen dann blicken auf schimmernden, spiegelnden Tischflächen Königsbüsten verwundert auf Zitronen oder auf Eier, sind dazwischen, kehren sich ab. Wie auf einer Bühne spielen
sich in solchen enigmatischen Konfigurationen seltsame Beziehungen aus und ab. In der Verschiebung der Größenverhältnisse, in der emblematischen Begegnung von Natur- und Kulturprodukten werden
heiter und befremdlich selbstverständliche Gegensätze, Hierarchien, Ordnungssysteme unterminiert.
Dieses konstruktive Sehen verknüpft im offenen Horizont die Bilder und Objekte der Ausstellung Im Glashaus. Wie der durch das Glas veränderte und verändernde Blick
die Beschaffenheit des Sehens deutlich macht, so projizieren diese Arbeiten zwischen sinnstiftendem Bild und abstrakter Konstruktion perzeptive Zwischenräume, die ständig neu visualisiert und
erschlossen werden müssen.
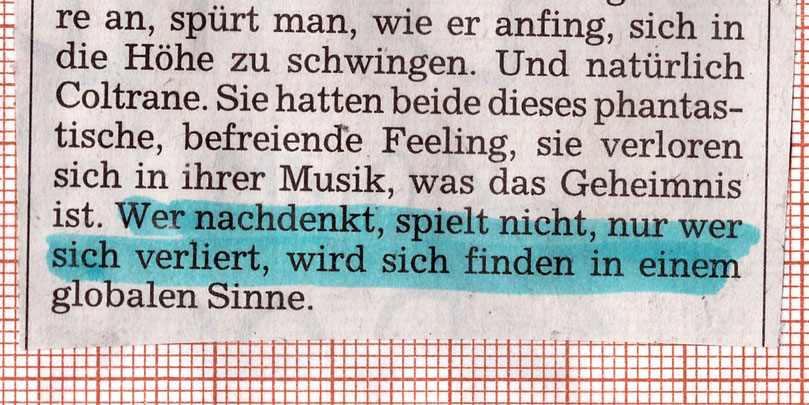
Dr. Kirsten Voigt | Friedrichsbau, Bühl, 2009
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
Sie alle kennen vermutlich das berühmte Bonmot Francis Picabias: »Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.« In Anlehnung daran und ähnlich
dadaistisch möchte ich sagen, die Welt ist groß, unser Kopf ist klein – und damit sie dennoch hineinpasst, haben wir etwas erfunden: Modelle. Bernd Hennig ist ein Modellkünstler, Modellfall eines
Modelleurs – zumindest in dieser Ausstellung –, der sich über sein Metier immer wieder Rechenschaft abgibt, auch indem er mit seinen Werken Grundbegriffe der Kunstgeschichte und künstlerische
Haltungen reflektiert. Flankierend stellt er zu seinen plastischen Werken theoretische Vorüberlegung über Grundlagen bildnerischen Handelns an, nicht zuletzt, da er auch als Professor – übrigens
für Zeichnung – in Dessau wirkt. In einem Vortrag für seine Studenten hat er deshalb systematisch jene Typen von Modellen unterschieden, mit denen wir in Kunst und Wissenschaft arbeiten. Ich darf
aus seinem Vortrag mit winzigen Abwandlungen zitieren, was er unterscheidet, nämlich
1. Modelle können maßstäblich verkleinerte Repräsentationen einer ‚groß‘ gedachten Wirklichkeit sein
2. Modelle können im Sinne von ‚Paradigmen‘ übergeordnete Regelsysteme beschreiben
3. Modelle kommen als Denkmodelle und damit als experimentelle Theorie vor
4. Modelle können ein Ideal repräsentieren und schließlich
5. Modelle können all das gleichzeitig sein und zwischen diesen Deutungen oszillieren.
Dieser vielfältig entfaltete Modellbegriff spielt für diese Ausstellung eine zentrale Rolle – es scheint so als umkreiste der Künstler ihn mit seinen bildnerischen
Werken, in Anspielungen.
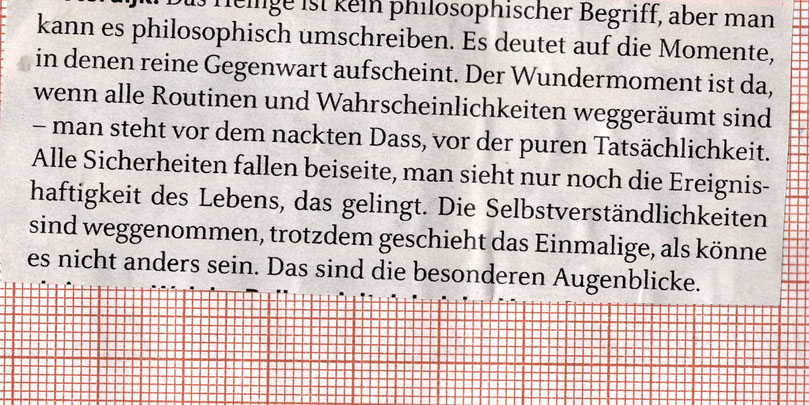
Wer Bernd Hennigs Werk vielleicht seit gut zwanzig Jahren kennt, wird sich zunächst im Blick auf die Einladungskarte und dann beim ersten Blick in diese Ausstellung
mit ihren zwölf installativen Inseln gewundert haben. Denn eigentlich kennt man Hennig als Abstrakten, der modellkleinen geometrischen Grundformen mit einer spielerischen und doch unverrückbar
erscheinenden Zielsicherheit gestalterisches Gewicht gibt, um sie so im Raum zu positionieren, dass ihre Anordnung gleichzeitig unerhört zwingend wirkt und doch dazu herausfordert, die
Konstellationen im Geiste umzustellen, sie als Manövriermasse für kreative Prozesse zu begreifen, die die Lust am Umdenken stimuliert. Das Kunstwerk verliert so seine geschlossene Form, alle
Unverrückbarkeit, das Endgültige und öffnet sich in Richtung auf eine Versuchsanordnung – ein Denk- und Weiterdenkmodell –, das immer vom Betrachter mit durchgespielt, weiter getrieben, umdacht
und umgedacht werden kann. Schwere Ringe, Behältnisse, Amphoren oder Vasen, kleine Türme, die er auch schon als »Universal- oder Weltmodelle« bezeichnete und die ihrerseits Zeichnungen und kleine
Objekte trugen, gruppierte Hennig auf Trägerplatten, Konsolen oder Simse, er installierte Wannen, in denen sich derartige Objekte befanden, oder sich Material scheinbar in verschiedenen
»Zuständen« darstellte. Für die Entwicklung dieser Objekte stand natürlich kein Modell Modell, sondern sie waren konkret gewordene Ableitungen vom Ideal der jeweils imaginierten Form – ohne
Vorbild in der Natur, der Welt des Organischen. Trotz ihrer geringen Ausdehnung wirkten die Objekt-Konstellationen auf eine Weise immer theatralisch, hatten sie einen großen, weil extrem
konzentrierten Auftritt auf der Bühne, die der Bildhauer ihnen auf seinen Spielflächen verschaffte, denn immer ließ Hennig seinen Objekten Raum. Vielleicht ist auch dies ein Geheimnis der
Anziehungskraft dieser Werke. Sie vergegenwärtigen nämlich ziemlich raffiniert ein Paradoxon: Nicht das Große, sondern gerade das Kleine verschafft sich Raum, weil sich der um ihn automatisch
weitet, ihm fast überall bleibt.
Auch in dieser Bühler Konstellation ist dies der Fall. Jetzt begegnen wir auf diesen Bühnen aber tatsächlich Darstellern und sie erscheinen sogar in Verbindung mit
Text – fast wie auf einer richtigen Bühne, hier jedoch dem geschriebenen, will sagen aus Corten-Stahl geschnittenen Wort, das schwergewichtig, als eherne Parole auf dem Boden liegt. Große Worte,
Begriffe von immensem Umfang wie »Ich«, »Sinn« oder »Welt«. Zuweilen begegnen uns diese Begriffe auch gewissermaßen abgepackt, in »Dosen«, Begriffe, die man auf Vorrat stapeln kann, auf Lager hat
– auch sie sind Spielmaterial für findige Köpfe, nicht zuletzt für Kunsthistoriker, Philosophen, Ästhetiker und Eröffnungsredner, und Bernd Hennig ironisiert den Umgang mit diesen Begriffen. Wir
haben sie verfügbar wie Etiketten, die man auf Behältnisse klebt, wir können sie füllen, entleeren, auslegen, verschieben, applizieren, damit jonglieren – und irgendwie scheinen die Dosen
austausch- und verwechselbar, ja vielleicht sind sie sogar leere Hülsen.
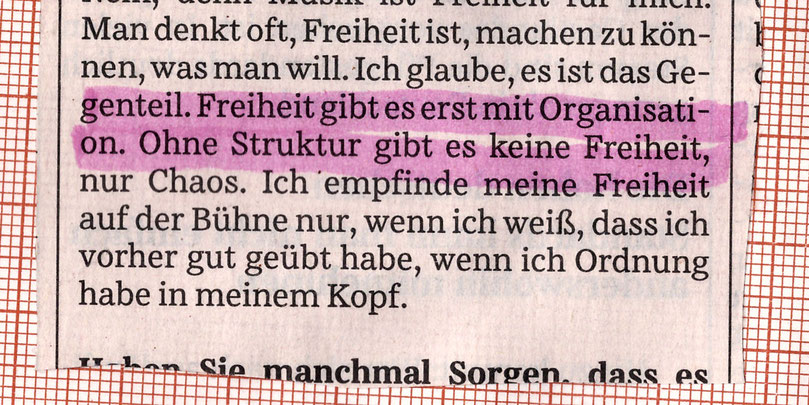
Abgezogene Hüllen – wir erinnern uns an den gehäuteten Marsyas und mittelalterliche Märtyrer-Darstellungen genauso wie an die Ästhetik des Gruselkinos, denn Hüllen
haben etwas mit Häutung und Verwandlung, mit Täuschung und Verwirrspielen, mit Maskierung und dem Verborgenen zu tun, mit dem Schreck, der sich mit dem Enttarnen verbinden kann – diese Hüllen
also kommen auch auf den Plattformen vor und relativieren den plastischen Körper, deuten an, dass er als Kunstform auch eine Leerform ist, ein Hohlraum, eine Vortäuschung falscher, kompakterer
Tatsachen. Primär ist diese Konstellation wie geschaffen dafür, ein Nachdenken über Haut und Kern, Außen und Innen zu animieren, über das Aushärten des plastischen und elastischen Materials
einerseits und konservierte Flexibilität andererseits, das Weiche und Anschmiegsame, das zum Erstarrten im Kontrast steht. Auf einer anderen Ebene ist die erschlaffte Außenhaut aber vielleicht
auch eine Spur kunstkritisch, indem sie auf den Täuschungscharakter der Objekte verweist, darauf, dass sie nur ein Abziehbild des Realen sind. Das könnte ebenso ironisch gemeint sein oder
gedeutet werden wie die eingedosten Begriffe kunstwissenschaftskritisch.
Figuren stehen zu den stählernen Begriffen in verschiedenen Haltungen im Verhältnis. Mal blicken sie auf den Begriff herab, dann stehen sie auf ihm wie auf einer
Basis, mal sind sie weiter von ihm entfernt, mal treten sie ihm näher. Zumindest ist eindeutig, dass hier ein Abstraktum etwas sehr konkretem begegnet: ein Wort einem Körper. Dieser Körper wirkt
klassisch. Er ist entkleidet, wohlgeformt. Die Figur steht im Kontrapost, also auf einem Standbein mit ponderiertem Körper, das heißt die Achsen von Schulter und Hüftpartie sind gegeneinander
verschoben, so dass das Standmotiv gleichzeitig ein entspanntes Gleichgewicht und dennoch das Potential zur Bewegung mit dem Spielbein andeutet.
Die Figuren stellen nichts dar als sich selbst, aber was uns da entgegentritt, hat reale Vorbilder – das weibliche Modell, nach dem Hennig zunächst ein Tonmodell
modelliert, heißt Olivia. Bis aus Olivia, dem Modell, eine Figur in einer Größe wird, von der man eigentlich mutmaßen könnte, sie sei ein Modell für wiederum Größeres, müssen verschiedene
Abformverfahren einsetzen, die schließlich zu Gips- oder Betongüssen führen, wie wir sie in dieser Ausstellung finden, teils farbig gefasst – dann handelt es sich um die Gipse -, teils im
stumpfen, hellen, zeitlos neutralen Grau des Betons.

Die Anordnung der plastischen, zeichnerischen und verbalen Elemente auf den Plattformen hat den Charakter einer Spielanordnung, die einen Moment zwischen den Zügen
festhält und damit etwas Transitorisches suggeriert, und uns ins Spiel kommen lässt. Und unsere anarchische Spielfreude erhält da umso mehr Nahrung, wo die Spielregeln unsicher sind, wo wir nicht
wissen, was gespielt wird. Tatsächlich nehmen sich manche Konstellationen skurril und surreal aus. Dass die Figur immer eine Badekappe trägt, hat den einfachen Grund, dass Bernd Hennig, wie er
selbst sagt, keine Haare brauchen kann, weil sie immer Zeichen einer Zeit sind, einer Mode, die Figur auf eine Epoche festlegen. Es gibt keine zeitloseren Figuren als Torsi – nicht zuletzt aus
diesem Grund.
Mitunter machen Latex-Verhüllungen die Physiognomie der Figuren unkenntlich. Der verschleierte Kopf wirkt unheimlich und vieldeutig: Verbirgt hier ein Trauernder
oder jemand vor Scham sein Gesicht, tarnt sich diese Person oder will sie nicht wahrnehmen, was ihr bevorsteht? Welches Gebot nötigt sie zu dieser Geste, wo sie doch ansonsten in unverhohlener
Nacktheit vor uns steht?
Tatsächlich dividiert Hennig hier die beiden Elemente traditioneller figurativer Bildhauerei auseinander: Körper und Gewand. Ganze Epochen der Kunstgeschichte
definiert diese über eben jenes bildhauerische Problem, wie der Körper sich durch das Gewand auszusprechen oder sich in ihm verbergend aufzugehen habe. Am Umgang mit dem Textilen und seiner
Textur bemaß man Meisterschaft und Modernität: Ob Plissee oder Schüsselfalten, ob »weicher Stil« oder eine flamboyante Auffassung des Gewandes als vom göttlichen Geist wogend bewegter Stoff –
Gotik, Renaissance, Manierismus und Barock deklinieren die Figur mit Hilfe des Gewandes durch, wenn sie nicht zur heiligen, heroischen oder sinnlichen Nacktheit finden. Bernd Hennig
exemplifiziert es am Beispiel von Berninis »Verzückung der heiligen Theresa«, einem höchst lustvollen und erotisch aufgeladenen Kunstwerk. Was sich hier zwischen dem Engel und der Heiligen
abspielt, wird durch eine dramatisch gebauschte und geknautschte Draperie ausgedrückt und verhüllt zugleich. Und Hennig weiß als Kollege Berninis: Die Lust am Machen, die Faszination dafür, was
mit dem Material möglich ist, führt den Künstler zu einer solchen Komposition, zur Wahl seiner Mittel und Motive, zu den Problemen und deren Lösung – nicht der Begriff, das Konzept, sondern der
Prozess des Arbeitens gibt den Ausschlag für die Komposition, eines entwickelt sich aus dem anderen. Die Reflexion setzt dabei nach und nach ein, am Anfang steht das haptische und optische
Vergnügen am Material, die Frage, wie weit man mit ihm etwas anderes illusionieren kann, wie weit man ein Requisit variieren, ihm Bedeutungen entlocken oder auferlegen kann, wie weit man etwa das
dekorative und funktionelle Agieren mit dem Stoff als Sujet treiben kann, bevor er seine Tragfähigkeit einbüßt. Die Draperie ist Dekoration und Bedeutungsträger, sie changiert zwischen beidem
ebenso wie sie zwischen den Funktionen von Verhüllen und Enthüllen oszilliert und damit als Attraktor wirkt.
Anregend befremdlich ist auch der Umstand, dass wir offenkundig immer wieder ein und derselben Figur als Person begegnen und dass diese sich sogar selbst begegnet. Sie ist ganz offenkundig ein Prototyp mit Doppelgängern, ja wenn wir eine der Arbeiten betrachten sogar mit Antipoden, sie kann in Serie gehen, das heißt, der Künstler ist gänzlich uninteressiert an einem Individuum und dessen Porträt, sondern konzentriert auf den Modellfall des Verhältnisses von Figur oder Mensch zu seiner Umwelt, Gegebenheiten wie sinntragenden Einheiten, Konfigurationen im wahren Wortsinn oder lediglich dem Raum. Einzig die Körperhaltungen dieses Modells variieren. Sie wendet den Kopf zuweilen, dreht den Oberkörper, hebt oder senkt das Haupt.
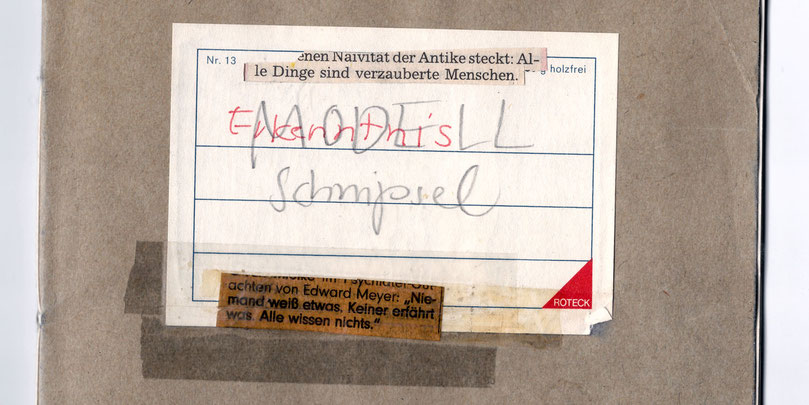
Viele der Konstellationen, auch in den Zeichnungen spiegeln auch Elemente des Arbeitsprozesses: Die Drehscheibe auf der das Modell steht und auf dem es fotografiert
wird, die Modellierscheibe, auf der jener Tonklumpen gedreht wird, aus dem dann ein Menschen-Abbild wird, sie tauchen in einer Art Weltscheibe auf, die wir in einer der Arbeiten wiederfinden und
sie begegnen uns wieder, kombiniert mit einem männlichen Kopf, in einer der hochinteressanten Drahtzeichnungen. Hennig hat hier ein Verfahren entwickelt, dass ihm höchst reizvolle Möglichkeiten
eröffnet. Zwischen zwei Japanpapiere legt der Künstler Draht, er zeichnet plastisch und lässt den Draht, der mit Kleister eingestrichen, fixiert und also feucht wird, die Zeichnung eigenständig
fortsetzen, vollenden. Die Figuren, die er hier entwirft, blühen auf, ihre Kontur ist nicht bis ins letzte Detail vom Künstler kontrolliert, sondern teilweise zufällig entstanden, entwickelt sich
weiter.
Farbpapiere liegen zuweilen außerdem zwischen den weißen Blättern, so dass hier zur Zeichnung Farbfelder treten, die Figur der harten Realität konstruktiver,
geometrischer Formen begegnet, ebenso lapidar wie unvermittelt – und seien diese auch so einfach in ihrem Verweischarakter erklärbar wie jenes Fliesenornament, dass eine Badezimmer- oder
Schwimmbad-Umgebung andeuten soll. Über diese Konfrontation zwischen Körper und gebautem Umfeld dachten schon die Künstler des Bauhaus in ihren Werken nach – mit Hang zum Gesamtkunstwerk, mit dem
Ziel, neue, klarere Verhältnisse herzustellen, eine Übersichtlichkeit, die einen emanzipativen Charakter hat, den Menschen zum rationalen und zukunftsoffenen Entwerfer, Akteur, Beweger, Beleber,
zum Zentrum seiner Umwelt zu machen, ihn vom Diktat des Zeitgeschmacks, des Dekorums, dem Ballast der Historie, der Verführung zu repräsentieren statt zu existieren zu befreien.
Dass hier nicht nur an den Wänden, sondern auch im Zusammenhang mit den plastischen Ensembles auf den Plattformen im Raum immer wieder Zeichnungen auftauchen, äußert provisorisch fixiert, umrisshaft, deutet den offenen Charakter dieses Arbeitens noch einmal an. Zeichnungen – genau wie Hennigs Installationen – operieren maßgeblich mit dem Element des Freiraums, des Gegenraums, der Leere, die so inspirierend und leicht wirkt. Zeichnungen zeigen die Meisterschaft ihres Urhebers in der Kunst des Weglassens. Die Installationen legen zuweilen den Gedanken nahe, dass hier einer, der etwas aufgebaut hat, zwischenzeitlich die Arbeit unterbrochen hat, um demnächst weiter zu wirken. Tatsächlich sind die Werke ähnlich entstanden, nämlich über einen noch viel größeren Zeitraum hinweg gewachsen, indem der Künstler Objekte aus verschiedenen Arbeitsphasen miteinander kombiniert – die Stahl-Schriftstücke existieren zum Beispiel schon weitaus länger als die Figuren nach Modell. So wächst in diesen Arbeiten zusammen, was in einen sowohl sinnlich als auch intellektuell prallen Werkkosmos gehört, in dem sich die einzelnen Gestirne auf Umlaufbahnen mal näher, mal weiter entfernt umeinander bewegen – und so umkreist der Bildhauer – wie auch wir – nicht nur sein Modell und seine Modelle, sondern auch seine Ideen und Themen. Ein wenig schwindlig kann einem dabei werden – aber dieser leichte Taumel ist so angenehm und belebend wie jener nach dem ersten Schluck Champagner oder der beim Walzertanzen.

Copyright © Bernd Hennig, 2025